Weltmusik ist ödes Dritte-Welt-Laden-Gedudel? Dann kennen Sie Leni Stern nicht. Mit ihrer E-Gitarre sorgte die Künstlerin im muslimischen Mali für guten Sound - und mächtig Wirbel.
Dass die schlanke Blonde aufgefallen ist, glaubt man gerne. "Eine weiße Frau, die elektrische Gitarre spielt, in einem Moslem-Land", berichtet Leni Stern, "meine Anwesenheit hatte eine mächtige Wirkung." In das westafrikanische Mali waren bisher nämlich vorwiegend schwarze Musiker gekommen – Afroamerikaner auf der Suche nach ihren Wurzeln, zum Beispiel die Jazzvokalistin Dee Dee Bridgewater, die dort ihr Erfolgsalbum "Red Earth" (Universal) aufnahm.
Wie Bridgewater arbeitete Leni Stern mit lokalen Musikgrößen im Studio des Weltmusikstars Salif Keita in der Hauptstadt Bamako. Und wie Dee Dee Bridgewater war Leni Stern von den afrikanischen Musikern begeistert.
Die Gitarristin und Sängerin ergänzte einige der Aufnahmen aus Mali in San Francisco mit Einspielungen des inzwischen verstorbenen Saxofon-Giganten Michael Brecker und ihres Mannes Mike Stern (Gitarre) und z.B. Wil Calhoun So entstand ein reizvolles Album aus afrikanischen und westlichen Musikformen.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Leni Stern -
"Das Leben ist ewiger Wandel"
ein interview - jazzdimensions.de
Mit "Words" brachte Leni Stern 1995 ihr erstes Album heraus, auf dem sie nicht nur an der Gitarre zu hören war, sondern sich auch als Sängerin und Texterin emanzipierte. Diese Richtung verfolgte sie konsequent weiter, und ihre nachfolgend eingespielten Platten sind mit Fug und Recht als Gesamtkunstwerke zu bezeichnen. Seit einigen Jahren ist die Künstlerin nicht allein mehr Gitarristin, Sängerin und Songwriterin, sondern in Personalunion gleichfalls auch Labelchefin und Produzentin.
"Finally The Rain Has Come" ist der Titel ihres neuesten Werks, das in diesen Tagen in Deutschland veröffentlicht wird. Die überzeugte Pazifistin beschreibt hier unter Anderem eindringlich das Leben in New York unter dem Schatten des 11. Septembers. Leni Stern hat hier ein Werk geschaffen, dass sich souverän zwischen den vorhandenen Schubladen von Songwriting, Jazz, Pop und Folk bewegt und für das ein neuer Genrename noch gesucht wird...
CP sprach in Berlin mit Leni Stern.
CP: Lange Jahre sahst du dich primär als Gitarristin. Du hattest es nach eigenem Bekunden gescheut, auch zu singen, um nicht als "Sängerin mit Gitarre" abgestempelt zu werden. Schließlich hast du dich dann doch entschieden, eigene Texte zu schreiben und zu singen. Wie kam das?
Leni: Ich habe mich wohl nach so langer Zeit in New York als englischsprechender Mensch empfunden und auch einfach das Gefühl gehabt, dass ich Texte schreiben kann. Aber erst in Zusammenarbeit mit Larry John McNally, mit dem zusammen ich "Black Guitar" geschrieben habe, entwickelte ich in dieser Hinsicht Selbstbewußtsein. Die Stücke schrieben wir zusammen und ich trug zum Text bei.
Larry, der ein begehrter, berühmter Texter ist, schrieb immer mit, was ich von mir gab. Und da habe ich bei mir gedacht, es aufschreiben könnte ich wohl auch selber. Und er hat mir auch Schriftsteller gezeigt, die englischsprachige Texte verfaßt haben, obwohl das nicht ursprünglich ihre Muttersprache war. So verlor ich die Scheu, auf Englisch zu schreiben und vielleicht mißverstanden zu werden oder ein Wort falsch einzusetzen. Es ist ja schwierig mit der Poesie – das ist ja eh schon schwierig, aber dann noch in einer anderen Sprache!
CP: Dein neuestes Album – in den USA ja bereits letztes Jahr erschienen - geht noch ein Stück weiter in Richtung Songwriting. Gleichzeitig ist es schwer einzuordnen: Rock, Jazz, Folk, Pop fließen ganz locker mit ein. Wo, in welchem musikalischen Umfeld, stehst du deiner Meinung nach selbst?
Leni: Gestern hat Norah Jones fünf Grammies gewonnen – als Protagonistin dieser nicht einzuordnenden neuen Strömung in der ich mich auch wiederfinde. Sie ist ja aus dieser frischen New Yorker Szene, in der sich Sänger und Instrumentalisten auf eine neue Weise vertragen. Nicht nur der Sänger steht im Mittelpunkt, sondern auch die Instrumente kommen in den Vordergrund, sind also eigentlich gleichberechtigt.
Diese Entwicklung ist schon seit fünf Jahren im Werden, nicht nur in New York. Es gibt noch keinen offiziellen Namen für diese Richtung, aber ich glaube, nach Norahs gestrigem Erfolg wird sich das ändern. Und es wird dann hoffentlich ein bißchen leichter für uns alle sein. Meist will, wenn sich so eine neue Stilrichtung entwickelt, erstmal niemand etwas damit zu tun haben. Die Jazzer sagen, es sei kein Jazz. Die Rockmusiker beschweren sich, dass es kein Rock sei. Die Country-Musiker sagen: viel zu viele Akkorde. Und die Singer-Songwriter wiederum sagen: zu elektrisch!
Man kann es im Grunde genommen keinem recht machen. Anstatt, dass man von allen willkommen geheißen wird, wird man von allen gemieden. – Aber das ändert sich in unserem Fall gerade, und ich finde es an der Zeit. Also bin ich sehr zuversichtlich, dass ich mit dieser Richtung von Musik ein größeres Publikum finden werde.
CP: "Finally The Rain Has Come" - zwei Songs dieses Albums hast du einen Tag nach dem 9-11 geschrieben, das Album selbst im darauf folgenden Monat eingespielt. Wie sehr hat diese Zeit in New York dein Leben verändert? Dauert das bis heute an? Wie sehr beeinflußt dich als weltreisende, in New York bzw. Amerika lebende Musikerin, das derzeitige politische Geschehen?
Leni: Also, die Ereignisse vom 11. September selbst haben mich weniger beeinflußt als die Reaktion darauf, und dieser anschließende Rechtsruck. Dass die Demokratie auf einmal so unpopulär geworden ist, und dass man deren Grundwerte so einfach zum Fenster rauswirft. Und sagt: "Wegen der Terroristen." Das ist jetzt das neue Standardargument. Und ebenso wie bei anderen Pauschalsachen erwischen die andauernd die Falschen. Wäre ja schön, wenn sie die Richtigen treffen würden, da wäre ich ja auch dafür. Aber bei diesem Wüst-um-sich-schlagen, da kommt nichts Gutes heraus. Und dazu kommt, dass auf einmal Krieg wieder populär ist.
Du siehst auf dem Cover meiner Platte ein Bild von Manhattan am 11. September, und dann gibt es noch ein Bild vom 12. September. Das ist ein Bild von einer Friedensdemonstration: Weil wir am meisten davor Angst gehabt haben, was unsere Regierung wohl als Antwort auf diesen Terroranschlag unternimmt.
Natürlich, wenn du in einer Stadt wohnst, an deren Ende auf einmal ein großer Friedhof entsteht, das ist etwas Intensives. Du bist plötzlich am Schauplatz einer Tragödie. – Aber ich muß sagen, die New Yorker sind ja eh solche Stehaufmännchen und nicht kaputt zu kriegen. Im Grunde genommen hat es das Beste aus den Menschen herausgebracht - drei Wochen lang fühlten sich alle einander verwandt.
Es sind von diesem posttraumatischen Streßsyndrom ja immer Leute auf der Straße zusammengebrochen. Und alle sind dann sofort stehengeblieben und haben getröstet. Und wenn jemand irgendwie verstört aussah, haben sie gefragt, ob alles in Ordnung sei, ob man helfen kann. Das hat sich natürlich später leider wieder verflüchtigt - aber das war schon unglaublich. – Es stimmte mich sehr hoffnungsvoll, wie die Menschen zu dem Zeitpunkt miteinander umgegangen sind.
Ich habe mich sogar auf einmal den Polizisten nahe gefühlt, was mir eigentlich sonst eher nicht so gegangen ist. Gerade in New York, weil unser Bürgermeister ja der Polizei einen Freibrief erteilt hat - und die einfach die Minderheiten niederknüppeln – "weil es ja eh die Schwarzen sind, die stehlen!" Und das fand ich sehr arg und schlecht, diese Polizeibrutalität, die bei uns in New York so überhand genommen hat.
Und auf einmal waren die Polizisten meine Freunde und ich habe ihnen Wurstbrote gebracht, wie sie da bei den Bergungsarbeiten geholfen haben. Das war etwas ganz Veränderndes. Du hast einfach die Menschlichkeit von allen Leuten gesehen. Gleichzeitig war nicht mehr alles so reglementiert wie sonst – wenn einer mal reinschauen wollte, wo etwas zugesperrt war, dann sagten die: "Gehen Sie ruhig durch, aber seien Sie ein bißchen vorsichtig!" – Das war einfach schön, nur trat leider kurz danach eben die offizielle Reaktion ein. Und es wurde toleriert, dass allgemeiner Araber-Hass um sich greift.
Dabei konnte man sehen, was die gängigen Vorurteile für ein Blödsinn sind, als die sich bei dem letzten arabischen Gipfeltreffen nach einer halben Stunde schon so zerstritten haben, dass die Sitzung beendet wurde. Die Araber sind so verschieden, dass sie nicht länger als eine halbe Stunde an einem Tisch sitzen können und wir schmeißen sie alle in einen Topf!
Genau wie bei uns auch, jeder will so wie er will – und keiner etwas zusammen machen. Und wir sagen dann "die Araber" – dabei gibt das es ja überhaupt nicht – genausowenig wie "die Europäer."
Ich bin sehr froh, dass Deutschland und Frankreich auf einmal doch noch Rückgrat entwickelt haben, ich wollte es ja schon nicht mehr glauben. Im letzten Dezember habe ich noch gesagt: ihr werdet es sehen, die Leute stehen auf, wenn es wieder so brutal zugeht! Und da haben alle gesagt, ach ja, die Leni träumt wieder... – Und jetzt sind sie aufgestanden, dabei hatte ich mittlerweile schon aufgegeben.
Meine Liedertexte wurden immer dunkler und finsterer. Ich dachte, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, mir fällt gar nichts mehr ein: "Ich bin sprachlos" heißt eines meiner neuen Stücke, "The Lost For Words." – Und auf einmal geht eine halbe Million Leute auf die Straße, von den Omis bis zu den kleinen Kindern, und sagt: "Nee, bitte nicht, wir wollen keinen Krieg!" Und das war schön.
Ich bin viel in Indien, in arabischen und moslemischen asiatischen Ländern gereist. Und ich muß gestehen, ich fand das auch nicht schön, wie die mich als Frau behandelt haben. Damals in New York, habe ich mich gefragt, was die westlichen Länder denen eigentlich angetan haben, dass die so sauer geworden sind. Das war zu pauschal, und ich habe mir damit auch ein Vorurteil gegen den Koran geleistet. Nach dem 11. September habe ich mal nachgelesen. Und natürlich steht im Koran nichts drin darüber, dass man Frauen schlecht behandeln soll.
Und ich verstand auf einmal, dass es den Arabern so geht, wie uns mit den rechtsradikalen Katholiken. Diejenigen, die Abtreibungsbefürworter erschießen lassen und das richtig finden. Und dann habe ich das alles ganz anders gesehen. Ich glaube, jeder muß mit dem Vorurteil kämpfen. Das ist zwar menschlich, dass man sich den einfachsten Weg sucht, aber es ist auch ganz wichtig, dagegen vorzugehen.
Hierzu eine Geschichte: Bei mir in der 11ten Straße in New York, da steht eine Moschee, das ist mitten im East Village. Und da herrschte immer eine gewisse Spannung, weil die Herrschaften im East Village natürlich die extremste Kleidung haben (lacht) – also so wenig wie möglich anhaben –, alle gepierct, und alles in bunten Farben. Und das ist den Imams wohl schon ein "Dorn im Turban" gewesen.
Mein Studio ist in der 10ten Straße und ich bin da vorbeigegangen, abends, vom Studio nach Hause und sehe wie so ein langarmiger Kerl einen Stein in das Moscheefenster reinschmeißt. Aber einen solchen! Einen richtigen Stein – wenn da jemand dahinter gestanden hätte, wäre er unter Umständen erschlagen worden. Und dann fängt der Typ an, laut auf die "Scheiß-Araber" zu schimpfen – also richtig loszulegen.
Und ich habe mit dem einen Streit angefangen. Und mittendrin dachte ich mir, um Gottes Willen, du kannst doch jetzt hier nicht mit einem Verrückten diskutieren! Und bin dann nach Hause gegangen, aber mir ist auf einmal die Kristallnacht eingefallen...
Und am nächsten Tag bin ich auf dem Fahrrad an der Moschee vorbeigefahren und da standen der Imam und zwei von seinen Helfern. Und ich radle so vorbei und hatte, weil es sehr heiß war, nur so ein Tanktop und meine Jeans an. Und habe spontan einfach vom Fahrrad gewinkt und Hallo gerufen.
Ich dachte später, das war wohl auch nicht so die richtige Art, wie man den Imam anspricht, so mit "Hallo" – aber das Tolle war, dass die alle zurückgewunken haben. Siehste mal, was da passiert! Die schauen uns jetzt eventuell auch mal anders an, dass vielleicht nicht die mit den rosa Haaren und dem Ring in der Nase "die Sünder" sind. Sondern die im Anzug, die den Stein ins Fenster werfen. Und das fand ich ganz hoffnungsvoll. Und dieses Bild ist mir geblieben, weil wir uns wohl beide bewusst wurden, dass die Situation irgendwie komisch ist.
Und es geht ja im Grunde genommen nicht darum, wer recht hat, sondern, dass wir uns alle miteinander vertragen, die wir alle hier zusammen sind. Es hat ja niemand was davon, wenn wir uns streiten. Ich verstehe auch nicht, dass das den Leuten so schwer reingeht, in den Kopf.
CP: Deine Songs sind oft sehr persönlicher Natur – man merkt den Liedern an, dass du mit deinen Emotionen und Gedanken stark involviert bist. Wie ist das bei Live-Auftritten: ist es eine Überwindung, sich einem Publikum auf dieser Ebene zu öffnen?
Leni: Es ist ein Fehler zu glauben, es seien nur persönliche, selbsterlebte Themen – sie sind lediglich aus dem Persönlichen geschöpft. Ich hatte mal einen Lehrer, der gesagt hat, man solle über das schreiben, was man kennt. Damals war ich wohl zu weit aus meinen eigenen Erfahrungen herausgegangen. Da sagte er (weil das Eigene einem oft zu gewöhnlich vorkommt): Schreibe über das, was du wirklich siehst. Beschreibe, was auf deinem Tisch liegt. Schreibe aus dem persönlichen Leben.
Ich meine, das gibt es schon bei Singer-Songwritern, dass alles persönliche Beichten sind, autobiografische Sachen. Das sind sie bei mir nicht, sondern es sind Geschichten; eine Art Szenenmonologe. Ich bin aber sehr froh, wenn die Leute denken, dass sie persönlich sind, weil es beim Singen genauso wie bei der Schauspielerei ist: Man muss dem Protagonisten glauben, sonst ist es fad. Es sind nicht meine persönlichen Erfahrungen, eher Bilder von kollektiven Erfahrungen, die alle gemeinsam haben. Das ist das Schöne dran, dass man sich damit identifiziert. Weil sich jeder beispielsweise wie in "Empty Hands" von einer alten Liebe nicht lösen kann. Sowas ist ja jedem schon mal passiert. Oder dass, wie in "Love Everyone", jemand gestorben ist, den man eigentlich unbedingt noch bei sich haben möchte.
Als Schriftsteller schreibst du die Sachen persönlich, in der Ichform. Aber es ist selbstverständlich nicht das "persönliche Ich" des Schriftstellers, sondern es ist ein Protagonist, den der Schriftsteller erfindet, der dem Zuhörer als Vorbild oder als Identifikationsfigur dient. Genauso sind das "Ich" oder das "Du" in den Liedern eine Metapher, eine übertragene Person. Natürlich müssen die eigenen Empfindungen mit eingebracht werden, weil es sonst ja keine Dynamik hat, und weil man das doch wohl am Genauesten kennt.
Ich glaube aber nicht an die Musik als persönliche Psychotherapie. Auch das gab es ja mal ... Klaus Kinski kommt mir da in den Kopf, und Edith Piafs "Non, je ne regrette rien." Wirklich persönliche Statements halt. Das ist bei der Art, wie ich Lieder schreibe, eher nicht der Fall. Ich sehe mich als Storyteller in der Tradition der Geschichtenerzähler, was Singer-Songwriter ja eigentlich sind. Und das Storytelling, das Geschichtenerzählen, ist etwas sehr Schönes – von den alten Bluesgitarristen hin bis zu meiner Omi.
CP: Wie kam es dazu, dass du dein eigenes Label gegründet hast? Würdest du es, rückblickend, wieder tun - oder siehst du es nach wie vor als Erfolg an, als Sache, die du gerne machst? Eine Idee war, auch anderen Künstlern eine Plattform zu bieten - ist das nach wie vor vorgesehen?
Leni: Ich habe dafür bis jetzt noch keine Zeit gehabt, daran hat es gehangen. Ich möchte das Label im Moment noch niemand anderem zur Leitung übergeben. Das kann ich mir natürlich vorstellen - und müßte es auch machen, wenn ich einen anderen Künstler mit reinnehme. Larry John McNally hat eine Platte bei uns veröffentlicht, und das war schon an der Grenze – diese zwei Terminkalender zu koordinieren, mit Interviews und allem.
Es ist natürlich schön und wird auch viel rentabler, je mehr Künstler man hat. Ich habe viele gute Ideen und es tut mir oft leid, das ich das nicht realisiert habe. Aber dann würde ich den Künstlern auch gerecht werden wollen - und nicht so wie gerade jene Plattenfirmen, bei denen ich mich beklagt habe, dass ich nicht genug Aufmerksamkeit von ihnen bekomme. Der Grund, warum ich eine Plattenfirma gegründet habe, ist einfach, das es jetzt mit der neuen Technik, mit dem Internet möglich ist, selbst für wenig Geld in der ganzen Welt Publicity zu machen. Und für wenig Geld in der ganzen Welt zu verkaufen.
Es macht eigentlich keinen Sinn mehr, die Kontrolle für eine Platte, die ja soviel Arbeit macht, abzutreten. Man kann ja statt dessen lediglich die Rechte und Lizenzen verkaufen und dann selbst noch weiter bestimmen. Vor allen Dingen ist die ganze Rechtslage in den neuen Medien noch nicht wirklich festgelegt. Jetzt den Plattenfirmen irgendwelche Pauschalrechte zu übertragen halte ich für falsch - bis das alles ein bißchen eindeutiger ist.
Ich produziere sehr gerne und stelle meine eigenen Bands zusammen und mir machen die ganzen damit zusammenhängenden Aspekte auch Spaß. Covers beispielsweise – ich habe viele Freunde, die Maler und Grafiker sind, oder Fotografen. Das ist dann so meine Werkstätte, mein Clan – die kommen auch alle zu den Konzerten. Und wenn ein neues Lied zum erstenmal gespielt wird, ist meine Freundin, die Fotografin, dabei und nimmt die Band auf. Das kommt dann auf die Website und so weiter. Ich finde das sehr schön, wenn alles organisch wird.
Die Atmosphäre bei den großen Plattenfirmen ist sehr unpersönlich, und ein großer Betrieb ist natürlich sehr langsam. Klar, würde eine von den großen Plattenfirmen mir ein Angebot machen, würde ich mir das wohl sicher überlegen – und vielleicht auch willkommen heißen. Mal ausprobieren, wie das wäre, mit so einem großen, weltweiten Apparat zu arbeiten.
Aber ich würde es nicht forcieren, weil eben einiges dafür, aber auch viel dagegen spricht. Ich habe eine Menge Freunde, die unter Vertrag sind, von denen Platten aufgenommen worden sind. Aber die Platten sind anschließend nicht erschienen. In der derzeitigen Marktlage kann man es sehr schwer garantieren, dass es für eine Veröffentlichung ein Budget geben wird...
CP: Du hast in deinem Leben eine schwere Krankheit überwunden. Wie sehr prägt das noch heute dein Leben? Hat deine Verbindung zum Kampfsport, zu den "Martial Arts" etwas damit zu tun? Du betreibst ja auch Kampfsportarten...
Leni: Ich muss das aus Gesundheitsgründen machen, weil die Chemotherapie alle möglichen Nebenwirkungen hatte: Herzschwäche, Knochenschwäche, Immunschwäche – alle möglichen Sachen. Und die ganzen Medikamente, die man dann nimmt gegen diese Schwächen... - und Medikamente gegen deren Nebenwirkungen und so weiter. Das war also ein Teufelskreis. Bei den Martial Arts bin ich gesund geworden.
Und vor allen Dingen habe ich meine Angst verloren: Das ist als Frau ein Wahnsinnsgefühl, wenn es auf einmal deine einzige Sorge ist, dass du dem Falschen eine reinhaust! Aber nicht mehr die Angst, dass du zum Opfer wirst, ermordet, vergewaltigt oder ausgeraubt wirst. Du hast nur Angst, dass sich der Betreffende bückt, und du dem Dahinterstehenden, Unschuldigen eine "watscht". Das ist im Grunde genommen mein größtes Problem.
Oder aber, dass ich möglicherweise – wie ich jetzt über einen Fall in der Abendzeitung gelesen habe – wegen Körperverletzung angeklagt werde. Weil mir bei jemandem die Hand ausrutscht, der versucht, mich zu vergewaltigen, und ich den ins Krankenhaus schicke. Das fand ich unmöglich, dass da eine Frau zwei Jahre auf Bewährung kriegt, weil sie den Typen in die Schulter gestochen hat. Und der wollte sie nicht vergewaltigen, der wollte sie umbringen!
Das ist als Frau ein Wahnsinnsgefühl,
wenn es auf einmal deine einzige Sorge ist,
dass du dem Falschen eine reinhaust!
Wenn ich solche Sachen lese, denke ich, oh, Vorsicht, lieber jetzt nicht die Kontrolle verlieren! Aber du lernst im Kampfsport ja wirklich, deinen Jähzorn und die Wut zu beherrschen und lernst, dich in solchen Situationen besonnen zu verhalten.
Und das ist als Frau wirklich ein gutes Gefühl, echt toll, wenn du um vier Uhr nachts in New York auf der Straße stehen kannst, mit zehntausend Dollar an Equipment, und ein Taxi rufen. Ja, wenn ich Räuber wäre, würde ich wohl auch zuerst zu mir hingehen – und nicht zu Brannen Temple, meinem riesigen texanischen Schlagzeuger, dem "blonden Monster" (lacht). Bei dem würde ich mir das überlegen, ob ich mich mit ihm anlege – und ich stehe da und rufe: "...Taxi!"
CP: Du lässt dich, sagt man, nicht so gerne als Vorbild vereinnahmen...: Es gibt ja viele, eine ganze Generation von Frauen, die sagen: oh, die macht das ja sooo toll...
Leni: Du ... das ist schon O.K.! Mein persönliches großes Vorbild war ja Carla Bley, und ich habe soviel von ihr gelernt. Diese ganze Idee von einer eigenen Plattenfirma hätte ich mich wahrscheinlich nie getraut, hätte ich nicht gesehen, wie die Carla das gemacht hat. Wie sie ihr Meisterwerk "Escalator Over The Hill" selber produziert hat, mit ECM, die damals ihr Büro noch in Parsing hatten, als Partner. Wie sie sich kompositorisch eben auch nur deshalb so entwickelt hat, weil sie ihre Musik mit niemandem diskutierte, sondern einfach nur gemacht hat.
Aber ich muß auch sagen, dass die allgemeine Einstellung dadurch, dass Künstler sowas mittlerweile auch selber finanzieren können, ganz anders geworden ist. Viele in der Industrie lassen die Künstler inzwischen machen, was sie wollen. Sie fördern und befürworten, dass sie ihr eigenes Konzept einbringen.
Aber ich glaube, das hätte sich nicht so entwickelt, hätten die Musiker nicht bewiesen, dass es der bessere Weg ist. Genau dadurch, dass sie ihr eigenes Geld in ihre Produkte reinsteckten und sehr erfolgreich wurden. Das war früher nämlich nicht so – aber die Künstler konnten es ja auch gar nicht, weil sie ja zum Beispiel nie die entsprechenden Erfahrungen im Produzieren gehabt haben.
Ich selbst habe das Produzieren bei meiner ersten Platte gelernt, weil der eigentliche Produzent, Hiram Bullock, aus mir sozusagen eine Produzentin gemacht hat. Obwohl ich geglaubt habe, ich könne das nicht. Aber er war der Ansicht, dass ich kann und hat mich dann gezwungen, Entscheidungen zu treffen; hat mir das nicht einfach abgenommen.
Du kannst mich also ruhig zum Vorbild erklären. Ist O.K. – Was ich nicht mag an diesem Dasein als Vorbild und Vorreiterin, ist, dass man dann von anderen Seiten immer angegriffen und angemosert wird: "Warum? Wieso? Was ist das denn jetzt?" – Diese Feindseligkeit, die geht mir ein bißchen auf den Wecker. Und vor allen Dingen möchte ich nicht auf irgendein Podest gestellt werden. Ich bin Gitarristin und Sängerin und Liedermacherin. Eine unter vielen anderen. Ich mache es so gut ich kann und alle anderen auch – wir haben sehr viel mehr gemeinsam als uns unterscheidet.
Auf so einem Podest wird es manchmal ein bisschen einsam, da oben drauf. Aber sonst, wenn also jemand ein Vorbild braucht: ich mache das gerne! (lacht) Ich bin jetzt wohl auch dran, nachdem ich mich selber von meinen vielen Vorbildern hab' ermutigen lassen.
CARINA PRANGE

















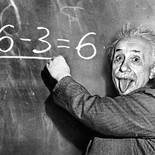





























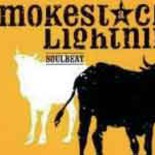




























_c.jpg)





